Neben seinem großen musikalischen Opus hat Richard Wagner (1813 – 1883) ein auch umfangreiches literarisches Werk hinterlassen. Die Schriften Wagners erstrecken sich von diversen theoretischen Auslassungen zu unterschiedlichen Themen über regen Briefwechsel bis hin zu einer Autobiographie, das Gesamtwerk der theoretischen Schriften allein umfasst in der Originalausgabe zehn umfangreiche Bände. Dabei zeichnet sich Wagner durch mehr oder weniger frei assoziierendes Schreiben aus, er legt uns zumindest keine wissenschaftlichen Arbeiten vor. Dabei wurde er in verschiedenen Phasen seines Lebens von unterschiedlichen Menschen, Philosophen und Denkrichtungen maßgeblich beeinflusst.
Die Theorien, die Wagner aufgestellt hat, waren und sind umstritten – man denke beispielsweise an das „Pamphlet“ Das Judentum in der Musik (1850 unter Pseudonym, 1869 unter eigenem Namen veröffentlicht. Alleine der in dieser Schrift geäußerten – vorsichtig ausgedrückt – bösen Polemik (etwa gegen Giacomo Meyerbeer) stehen durchaus freundschaftliche Beziehungen Wagners zu jüdischen Musikern gegenüber. Auch aus diesem Grund lassen sich drei Themenfelder identifizieren, die Wagner zu seiner abfälligen Schrift veranlasst haben können: Einmal kann man persönliche Motive in der Art und Weise der Verfolgung eigener Ziele konstatieren, und das – zweitens – in einer Phase der Verzweiflung in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schicksal (Exil und wiederkehrende Geldsorgen). Und drittens spielen nicht zuletzt gesellschaftliche Faktoren und Diskussionen der Zeit eine wesentliche Rolle. Und diese waren durchaus antisemitisch geprägt. So hatte Wagner mit dem Anarchisten Michail Bakunin, der als „rabiater Antisemit“ gilt, in den Jahren vor dem Dresdner Mai-Aufstand von 1849 engen Kontakt.
Gerade in der historischen Betrachtung ist zwischen dem Menschen „Richard Wagner“ und dem Musiker, Komponisten und Autor (der zufällig den Namen „Richard Wagner“ getragen hat), zu abstrahieren. Aber gerade aus diesem Grund besteht gleichzeitig die unbedingte Notwendigkeit der historischen Einordnung, um aufzuzeigen, in welcher Zeit, in welchem Kontext und unter welchem Einfluss die Werke und Schriften entstanden sind. Ganz entscheidend ist die Frage, wann Wagner was sagt, da er sich im Zuge seines Lebens diversen Zeitgenossen und Denkern (eben Bakunin, aber auch Ludwig Feuerbach oder GWF Hegel) zu- und abgewandt hat, verschiedene Weltanschauungen übernommen und für sich umgesetzt hat.
Festzuhalten bleibt, dass Wagner mit seiner Kunst, wie ebenso mit seinen Schriften, auch retrospektiv eben im Kontext der Zeit betrachtet werden sollte. Dieser Kontext meint die Stellung der Künstler im 19. Jahrhundert, bezogen auf die Art und Weise des Gelderwerbs (Auftraggeber sind im Wesentlichen die jeweiligen Herrscherhäuser, der Musiker braucht „sein“ Publikum, braucht Anstellungen, Aufführungsorte und Beziehungen). Und diese Tatsachen sind zu betrachten im Kontext der historischen Genese in Gesellschaft, Politik und Umgebung zur Zeit Wagners. Im Fokus stehen im Folgenden dabei auch die tatsächlichen Revolutionen der Zeit. Das Leben Wagners erstreckte sich auf die Jahre 1813 bis 1883 und fiel damit in eine Zeit weitreichender politischer und gesellschaftlicher Umbrüche. Zeitgenossen Wagners waren – neben den bereits Erwähnten – im philosophischen Bereich etwa auch Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, literarisch beispielsweise Heinrich Heine, in der Musik Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt und Robert Schumann. Portraitzeichnungen und -gemälde mit dem Abbild Wagners sind u.a. überliefert von Auguste Renoir und Adolph von Menzel. Und nicht zuletzt zu nennen ist selbstverständlich König Ludwig II. von Bayern, den man einerseits dem politischen Spektrum zuordnen, andererseits als Auftraggeber für musikalische Werke und Mäzen Wagners nennen muss.
Ohne Auftraggeber, ohne Anstellung und Möglichkeiten, Werke aufzuführen, war ein Leben als Künstler damals nicht finanzierbar. Parallel verdingte Wagner sich in seiner Dresdner Zeit daher – endlich konnte er sich zumindest für einige Jahre niederlassen, bevor er erneut fliehen musste – als Hofkapellmeister und Dirigent, wobei als Auftraggeber (Duplizität der finanziellen Abhängigkeit) wiederum der Herrscher, hier der König von Sachsen) fungierte und die Theater und Musiktheater unter höfischer Verwaltung standen.
Die Lebenszeit Richard Wagners war durch massive Umwälzungen geprägt. So erlebte Wagner die zunehmende Industrialisierung (die sog. „Industrielle Revolution“) mit allen auch negativen Auswirkungen auf die Menschen. Auch die politischen Veränderungen und Unruhen in seiner Zeit waren massiv: Deutscher Bund, der sog. „Deutsche Krieg von 1866“, der in die Gründung des Deutschen Reichs mündete – Wagner erlebte ebenso den polnischen Aufstand von 1830/ 1831, die Juli-Revolution in Paris von 1930, die Zeit des Vormärz, die Märzrevolution und speziell den Dresdner Aufstand sowie – gegen Ende seines Lebens – etwa noch die Pariser Kommune.
Neben der äußeren Umwelt spielte aber auch das innere Erleben Wagners eine maßgebliche Rolle. Zurückkommend auf das ambivalente Verhältnis zu jüdischen Zeitgenossen: Bereits Anfang der 1830er Jahre war Wagner tief verschuldet bei jüdischen Geldverleihern. Neben anderen Motiven kann hier bereits der Grundstein zum Antisemitismus Wagners vermutet werden. Und daher scheint stets das je innere Gefühlsleben, in dem sich Wagner zu bestimmten Zeiten, guten wie schlechten, ausgesetzt sah, ebenfalls eine relevante Rolle bezogen auf die Schriften der verschiedenen Lebensperioden zu spielen, wenngleich wohl heute nie mehr alle Motive Wagners erhellt werden können.
Als Theoretiker beschäftigt er sich mit einer Fülle an Themen, die er inhaltlich oftmals von anderen Denkern entlehnt und in seine Sicht einpasst. Damit erschafft er eine – nämlich seine – Weltanschauung und diese richtet sich je nach Lebensphase, in der er sich befindet. Eine Ambivalenz innerhalb der Schriften und überlieferten Zitaten Wagners muss dann unmittelbar festgestellt werden. Je nach eigenem Erleben stellt Wagner sich und seine Weltanschauungen unterschiedlich dar, als von unterschiedlichen Motiven getrieben, von je anderen inneren und äußeren Zuständen beeinflusst sowie je nachdem, an wen Wagner sich wendet oder mit wem er korrespondiert. Es ist somit notwendig, sich in der Beschäftigung mit Wagners Schriften und damit einhergehend mit seinem musikalischen Werk der Frage zu stellen, in welchem individuell-biographischen, gesamtgesellschaftlichen und rezeptionsgeschichtlichen Kontext Wagner in verschiedenen Phasen seines Lebens jeweils gearbeitet hat. Mit „welchem“ Wagner also beschäftigt man sich, in Zeit, Bezug, Werk und Rezeptionsgeschichte?
Letztlich spiegelt sich diese heterogene Vorgehensweise analog auch in Wagners musikalischen Werk wider: Bestandteile und Struktur des antiken Dramas der griechischen Mythologie, mittelalterlicher Balladen, tatsächlich historischer Persönlichkeiten oder Begebenheiten werden von Wagner vermischt und jeweils zu eigenständigen, dabei abend(über)füllenden Musikdramen zusammengeführt. Mythologie, Psychologie, Erlösungsmotive, Ideologien, biographische Einflüsse oder politisch-soziale Aspekte werden aufgenommen, mittels germanischer und antiker Quellen umgesetzt und schöpferisch in Einheiten transformiert.
Im Mittelpunkt der Schriften stehen Die Kunst und die Revolution von 1849 und Das Kunstwerk der Zukunft von 1849/1850. Das Sujet der Revolution in Richtung der politischen Situation diente Wagner dazu, seine Theorie der Revolution für den künstlerischen Bereich zu formulieren. Diese Revolution, eine Revolution, derer die Künstler – und ganz speziell er selbst – bedurften, um ihre prekäre Situation ansatzweise oder potentiell zu verbessern, zieht Wagner dann heran, um auf sich aufmerksam zu machen. Und gerade die hier diskutierten theoretischen Einflüsse haben dann einen speziellen Reiz auf Wagner in eben dieser Zeit, in diesem (vor-)revolutionären Moment ausgeübt.
Unerlässlich für jede Einordnung der theoretischen Schriften Wagners bleibt somit also die Frage, zu eben welchem Zeitpunkt, unter welchem Einfluss er was gesagt und niedergeschrieben (oder eben auch komponiert) hat. Das musikalische und das theoretisch-verschriftlichte Werk bleiben nebeneinander stehen. Richard Wagner hat in beiden Weltanschauungen produziert, die bis heute nachwirken.
Als Komponist wird Richard Wagner die Zeit in seiner Musik überdauern. Als Denker und Schriftsteller ist sein Werk meines Erachtens allzu heterogen, inkonsistent, zerfranst und unwissenschaftlich, um eine abschließende Beurteilung treffen zu können.
Zum Weiterlesen:
Geck, Martin (2013): Richard Wagner. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch-Verlag.
Gregor-Dellin, Martin (1989): Richard Wagner. Sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert. München: Piper.
Lütteken, Laurenz; Groote, Inga Mai; Wagner, Richard (Hg.) (2012): Wagner Handbuch. Kassel: Bärenreiter Metzler.
Wagner, Richard (2015): Das Kunstwerk der Zukunft. Neusatz durch Michael Holzinger. Createspace.
Wagner, Richard (1975): Die Kunst und die Revolution. München: Rogner Bernhard.
(Bildcredits: KI via starryai.)
Hat der Text Ihr Interesse geweckt? Dann diskutieren Sie mit!
Mein Unternehmen, die LOGOS Strategie Beratung Dr. Alexander Braml, finden Sie unter www.logos-strategie.de und mich finden Sie auch auf XING und auf LinkedIn.

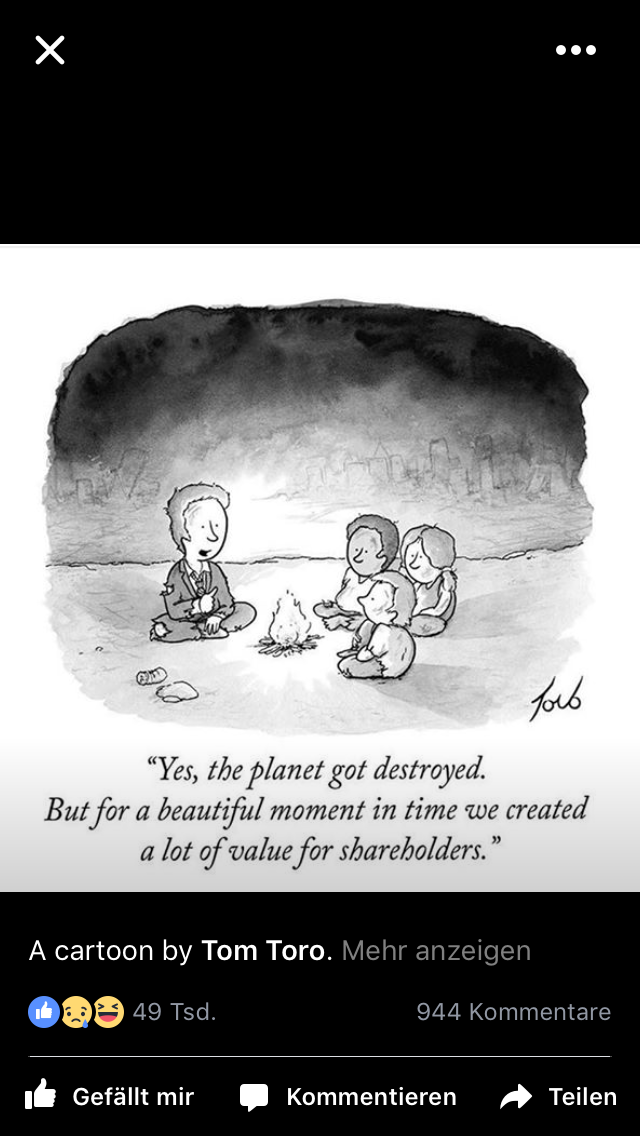








Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.